
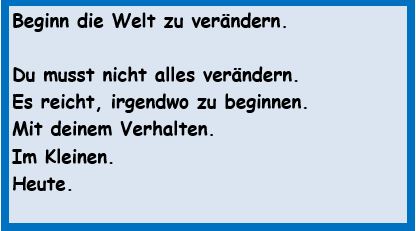
Herminenhof

Der Stammtisch stand immer links, gleich neben dem Kachelofen.
Ein schweres Ding aus dunklem Holz, zerkratzt von Jahrzehnten, mit Brandflecken von Zigaretten, die längst verboten sind, und Kerben, von denen keiner mehr wusste, wer sie hineingeschlagen hatte.
„Des war sicher der Franz“, sagte man.
Und der Franz sagte: „I war des nie – i hau ned daneben.“
„Gehma zum Wirtn“, sagte man früher nicht, weil man Hunger hatte.
Man sagte es, weil man reden musste. Oder weil daheim wer wartete, der auch reden wollte – und das war oft schlimmer.
Man redete über die Arbeit, über den Chef, über die Politik.
„Die Politiker san alle gleich“, sagte der Sepp.
„Na“, sagte der Hansi, „früher san’s wenigstens no schlechter gwesen.“
Dann wurde gestritten, gesudert, geschimpft – so laut, dass der Wirt nur mehr den Kopf schüttelte und meinte:
„Wenn des Denken wehtat, warat’s heut a ruhiger Abend.“
Die Fetzen flogen. Einer stand auf, schlug auf den Tisch und sagte:
„Mit dir red i nimmer!“
Der andere antwortete:
„Passt. No a Bier?“
Und zehn Minuten später tranken sie wieder zusammen, weil man sich zwar ärgerte, aber nicht trennte.
Der Wirt wusste, wann er nachzuschenken hatte und wann er lieber weggehen sollte.
„Noch eins?“, fragte er.
„Jo“, sagten alle.
„Aber nur a Kleines.“
Es wurde ein Großes. Wie immer.
Heute steht der Tisch oft leer.
Das Wirtshaus gibt es noch, aber man geht hinein wie in ein Bankinstitut. Man rechnet.
„Des kostet wos?“
„Ja.“
„Dann sans mir z’teier.“
Und daheim is dann die Tiefkühlpizza um drei Euro – aber halt ohne Gespräch, dafür mit Stille.
Zeit haben wir auch keine mehr.
Arbeit, Termine, Freizeitstress.
Wir laufen den ganzen Tag und wundern uns am Abend, warum wir nirgends angekommen sind.
Gesudert wird heute online.
Da kann man streiten, ohne dem anderen ins Gesicht zu schauen.
Praktisch.
Und feig.
Früher hat man sich nach dem Streit wenigstens noch ins Aug geschaut.
Und wenn gar nix mehr ging, sagte einer:
„Du host recht.“
Und alle wussten: Er hatte keine Lust mehr zu diskutieren.
Wohin führt uns dieser Weg?
Vielleicht sitzen wir in fünf Jahren noch immer nebeneinander – aber jeder schaut auf sein eigenes Kastl.
In zehn Jahren erzählen wir, dass es früher einmal Wirtshäuser gab, wo man gelacht hat, gestritten hat und trotzdem beieinander blieb.
Und in fünfundzwanzig Jahren stehen wir vor einem alten Gasthaus, lesen „Zu verpachten“ am Fenster und sagen:
„Schad drum.“
Und gehen weiter.
Ob wir unser Leben verändern? Sicher.
Ob zum Besseren?
Wie sagte der alte Wirt immer:
„Solang’s Bier no schaumt, is ned alles verloren.“
Der Stammtisch würde noch stehen.
Er hätte Zeit.
Er würde warten.
Man müsste nur wieder sagen:
„Gehma zum Wirtn.“
Manchmal fragt man sich, wie es überhaupt so weit kommen kann. Da sitzen irgendwo Menschen an großen Tischen, zeichnen Linien auf Landkarten und beschließen, dass andere für ihre Entscheidungen sterben sollen. Und plötzlich stehen wir wieder vor denselben Tragödien, die die Menschheit seit Jahrhunderten verfolgt: zerstörte Städte, zerbrochene Familien, Tränen, die nie versiegen.
Im Krieg gibt es keine Gewinner. Es gibt nur Menschen, die verlieren: Kinder, die ihre Eltern nie wiedersehen. Frauen, die auf Nachricht warten, die nie kommen wird. Mütter, die ein Foto umklammern, als wäre es das letzte Stück Wärme, das ihnen bleibt. Und Männer, die an die Front geschickt werden, obwohl ihr größter Wunsch vielleicht einfach nur ein friedlicher Abend zuhause gewesen wäre.
Das Absurde daran ist: Auf beiden Seiten stehen Menschen, die sich niemals etwas getan haben. Menschen, die dieselben Hoffnungen, dieselben Sorgen, dieselben Ängste teilen. Und doch sollen ausgerechnet sie gegeneinander kämpfen. Für was? Für wen?
Wer hat das Recht, andere in einen Krieg zu schicken? Wer nimmt sich heraus, über Leben und Tod Unschuldiger zu entscheiden?
Kriege entstehen in Köpfen — und dort könnten sie auch enden. Wenn wir endlich begreifen, dass Menschlichkeit nie Feind sein darf. Dass Frieden nicht verordnet werden kann, sondern gelebt werden muss. Und dass kein Konflikt der Welt so wichtig ist, dass dafür ein einziges Leben geopfert werden dürfte.
Am Ende bleibt nur die Erkenntnis: Krieg ist Wahnsinn. Und wir alle tragen die Verantwortung, ihn nicht als selbstverständlich hinzunehmen.

Hier stehe ich seit dem 3.Oktober 2014 als Schülerlotse
Mein Friseurmotto
Ich geb’s offen zu: Haare schneiden ist für mich eher ein Notfallprogramm als ein Wellnessritual. Ich schiebe es raus. Immer wieder. Und noch ein bisschen. Bis der Blick in den Spiegel mir unmissverständlich klarmacht: Jetzt ist’s aber wirklich soweit!
Und dann – zack! – ist es soweit. Ich greif zum Telefon und ruf dort an, wo man mein Motto nicht nur kennt, sondern auch respektiert:
d’Hübschmocherei in der Salzburgerstraße in Wels.
6 Millimeter in 5 Minuten.
Keine Haar-Philosophie, keine Experimente, keine Diskussion. Einfach schnipp, schnapp – und gut is’.
Gestern war es wieder so weit. Der Wildwuchs wurde gestutzt. Und wie immer: freundlich empfangen, zügig bedient, exakt nach Wunsch frisiert. Das Personal? Supernett. Die Atmosphäre? Locker und angenehm. Keine Smalltalkpflicht, wenn man nicht mag – aber ein Lächeln gibt’s gratis dazu.
Und das Ergebnis?
Genau wie ich’s will: kurz, sauber, fertig. Keine Ahnung, was sie da alles in fünf Minuten machen – aber es funktioniert.
Wer wie ich keine Lust auf „nur die Spitzen“ und stundenlanges Stylen hat, sondern lieber klare Ansagen und flotte Umsetzung will – der ist in der Hübschmocherei genau richtig.
Ich komm wieder. Keine Frage.
Aber halt erst wieder … wenn’s wirklich nicht mehr anders geht. 😄

Der Wunschbrunnen
Drei alte Freunde – Neid, Hass und Gier – standen eines Tages vor einem geheimnisvollen Wunschbrunnen.
„Ein Wunsch für jeden von euch“, sprach der Brunnen. „Doch denkt gut nach – was ihr wünscht, wird auch Konsequenzen haben.“
Neid trat vor. „Ich wünsche mir, dass mein Nachbar ein schiefes Haus hat – meins soll wenigstens geradestehen!“
Der Brunnen gluckerte leise – und Neids eigenes Haus sackte schief in den Boden, während das des Nachbarn verschwand.
„Verdammt! Jetzt hab ich gar keinen mehr, auf den ich neidisch sein kann!“
Hass knurrte. „Ich will, dass alle, die ich verachte, vom Erdboden verschwinden!“
Ein grollendes Echo hallte – und Hass stand plötzlich allein in einer stillen Welt.
„Mist. Jetzt ist keiner mehr da, den ich hassen kann!“
Gier lächelte und trat selbstsicher vor. „Ich will ALLES! Gold, Macht, Ruhm – die ganze Welt soll mir gehören!“
Der Brunnen zögerte, dann antwortete er: „Sehr wohl.“
Ein grelles Licht – und Gier stand auf einem Thron. Alles gehörte ihm. Alles. Auch der Neid. Auch der Hass.
Und mit ihnen kam… die Langeweile.
Denn alles zu besitzen, bedeutet auch: nichts mehr zu begehren.
Und so saßen die drei da – neidisch auf die Zufriedenen, hasserfüllt gegenüber dem Leben und gierig nach dem, was sie nie verstehen werden: Genügsamkeit.