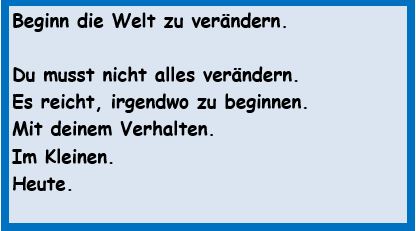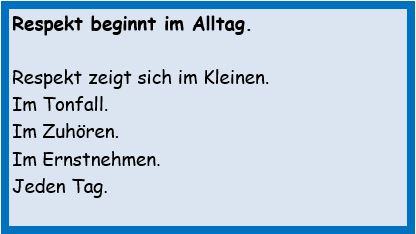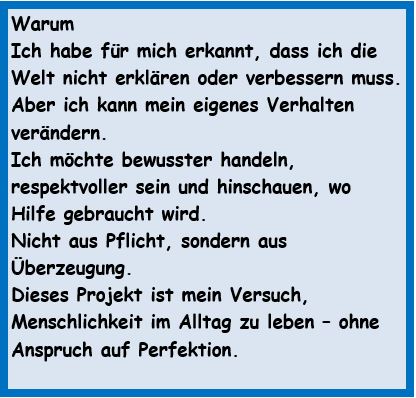Wirtshausgeschichten von Früher

Es war einer von diesen Abenden, wo man schon beim Reingehen gespürt hat, dass heute nix ruhig bleibt, der Karli saß wie immer leicht schief am Stammtisch, das dritte Bier vor sich, den Blick zu lang auf den Sepp gerichtet, der Sepp war gut drauf, vielleicht zu gut, lachte viel, redete noch mehr und legte der Oidn vom Karli beim Lachen einmal zu oft die Hand auf den Arm, der Franz murmelte noch „host du des g’sehn“, der Wirt nickte nur und zapfte weiter, weil er wusste, wie das im Wirtshaus läuft, der Karli hielt’s nimmer aus, stand auf, sagte nix, und dann ging’s schnell, a paar Watschn, mehr aus Eifersucht als aus Wut, mehr gekränkt als brutal, die Oide schrie, der Sepp wich zurück, der Stammtisch stand auf, aber keiner griff sofort ein, nicht aus Feigheit, sondern weil man im Wirtshaus weiß, dass man zuerst schaut, ob sich’s selber regelt, der Wirt stellte ein Bier vor den Karli, dann eines vor den Sepp und eines vor die Oide und sagte nur ruhig „setzt’s eich, jetzt red ma“, und sie redeten, laut, ungeschickt, mit vielen Pausen und noch mehr Bier, nix war wirklich gelöst, aber alles war gesagt, der Karli setzte sich wieder, der Sepp auch, die Oide trank ihr Bier aus und sagte leise, aber klar „i bin ka Besitz“, keiner lachte, aber alle nickten, und wie’s im Wirtshaus halt is, redeten sie eine Stunde später über Fußball, der Tisch blieb ganz, die Gläser auch, und irgendwer meinte noch „zahlst die nächste Runde, Karli“, und der Karli zahlte, wie immer.